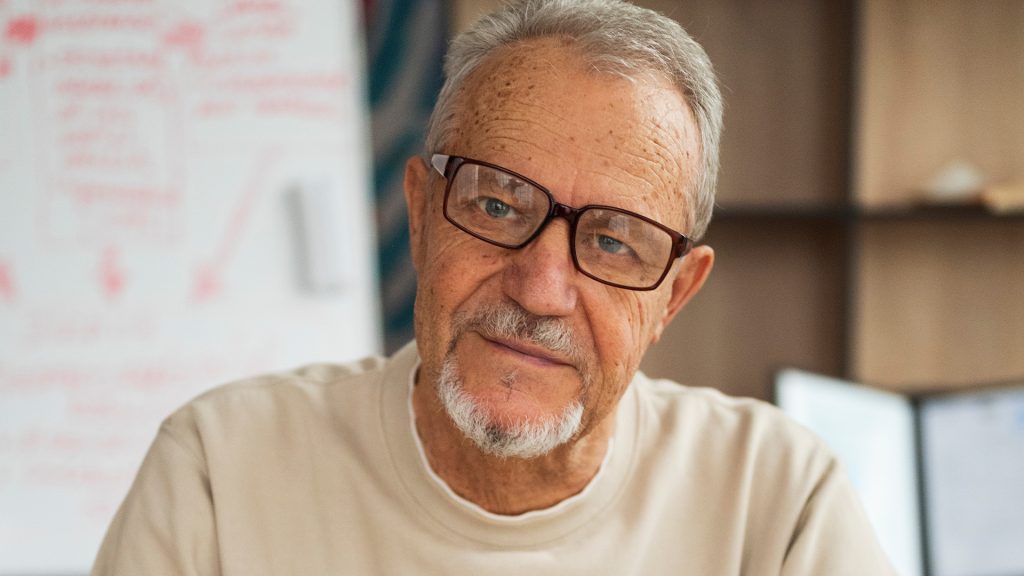VEREIN
Das Niedersächsische Institut für die Gesellschaft Gehörloser und Gebärdensprache e.V. (NIGGGS) wurde am 17. März 2001 gegründet. Wir sind Ansprechpartner und Treffpunkt für Menschen, die direkt oder indirekt mit der Gebärdensprache, den Hörgeschädigten und der Kultur der Hörgeschädigten in Kontakt sind, oder treten möchten.
Hierzu zählen Gehörlose, Angehörige, Pädagogen und SozialarbeiterInnen, GebärdensprachdolmetscherInnen und -dozenten uvm.
NIGGGS fördert bzw. bietet insbesondere folgende Bereiche an:
- Gebärdensprachkurse
- Weiterbildung in Seminaren und Workshops
- Weiterbildung der Pädagogen für Hörgeschädigte
- Weiterbildung der Gebärdensprachdozenten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erfahrungsaustausch
Mehr über NIGGGS e.V.: In den Downloads findet ihr unsere Satzung, den Mitgliedsantrag & Informationsbroschüren.

BERATUNG

FÜR HÖRBEHINDERTE

FÜR ANGEHÖRIGE
KURSANGEBOT
Alle Informationen zu unseren Kursen und die Kursanmeldung findet ihr hier:
Kursangebot und Infos für Eltern
Kursangebot für Firmen
KONTAKT

Niedersächsisches Institut für die Gesellschaft Gehörloser und Gebärdensprache e.V.
Nutzt gerne unser Kontaktformular, um mit uns in Kontakt zu treten. Wir helfen gerne.